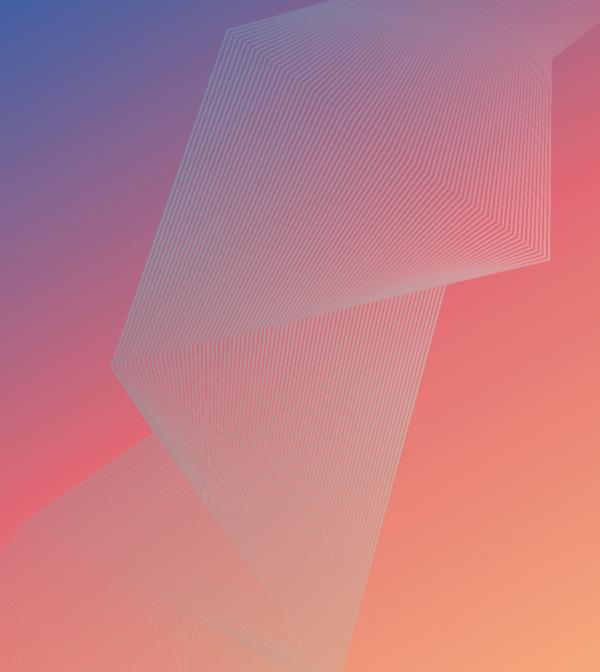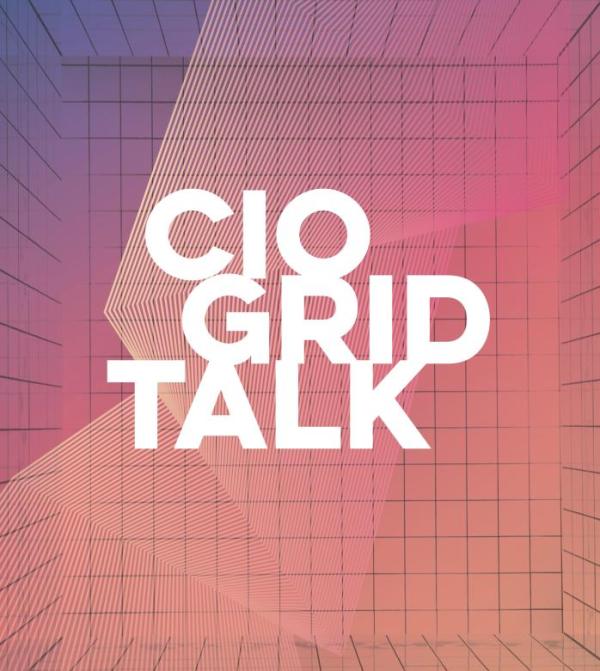Rückblick auf den CIO Kongress 2025 – über Mut, Haltung und die neue Realität digitaler Führung
Es war kein gewöhnlicher CIO Kongress. Schon das Leitmotiv „INTEAM“ ließ erahnen, dass hier nicht über Bits und Bytes gesprochen werden würde. Während anderswo die neuesten Sprachmodelle und Cloud-Innovationen gefeiert wurden, stellte der CIO Kongress 2025 eine andere, unbequemere Frage: Wie führen wir, wenn Maschinen mitentscheiden und Menschen dennoch verantwortlich bleiben?
Der Mensch als Architekt der Transformation
Bereits zum Auftakt machte Martina Kruber (LSZ) klar, dass Digitalisierung mehr ist als Technologie:„Technologie entscheidet gar nichts - der Mensch entscheidet alles.“
Dieser Satz wurde zum inoffiziellen Leitmotiv der drei Tage. Er lenkte den Blick weg von Systemarchitekturen hin zu Denkarchitekturen. Reinhard Gussmagg, der den Kongress mit seinen visuellen Denkmodellen eröffnete, zeigte, dass Veränderung ohne innere Bilder nicht gelingt. „Innere Bilder schaffen Orientierung“, sagte er – und erinnerte daran, dass Führung immer zuerst im Kopf beginnt, bevor sie in Organisationen wirkt.
In einer Zeit, in der KI das Denken externalisiert und Prozesse automatisiert, rief Gussmagg in Erinnerung, dass Transformation ohne menschliche Vorstellungskraft blind bleibt. Der CIO der Zukunft, so seine These, müsse nicht nur Systeme verstehen, sondern Sinn gestalten.
Mut als neue Währung der Führung

Diesen Gedanken griff Peter Baumgartner auf - mit einer simplen, aber kraftvollen These: „Mut verändert alles.“
Mut, so Baumgartner, sei die wahre Knappheitsressource in Organisationen. Nicht Kapital oder Technologie, sondern die Bereitschaft, Verantwortung emotional-intelligent zu übernehmen, entscheide über Erfolg.
Im anschließenden DACH-Panel mit Claudia Pohlink (Deutsche Bahn) und Andreas Thöni (Österreichische Post), Ulfried Paier (Know Center) und François Habryn (Kyndryl) wurde deutlich, dass künstliche Intelligenz kein Ersatz für menschliche Urteilskraft sein darf. Pohlink brachte es auf den Punkt: „KI muss den Menschen ergänzen, nicht ersetzen.“
Ein besonderes Highlight war die erstmalige Verleihung des AI Excellence Award Austria, den Brantner Green Solutions für seinen „KI-Biostörstoffscanner“ gewann – ein Projekt, das zeigt, wie künstliche Intelligenz ökologische und wirtschaftliche Mehrwerte schaffen kann.

Abseits der Hauptbühne boten die zahlreichen Workshops und Breakout Sessions an allen drei Kongresstagen die Gelegenheit, die Impulse der Keynotes in konkreten Anwendungsfeldern zu vertiefen. In interaktiven Formaten wurde an Use Cases, Führungsfragen und strategischen Roadmaps gearbeitet - stets mit Fokus auf die praktische Umsetzung.
Die Themen reichten von AI-Strategie und Automatisierung über Cybersecurity und digitale Souveränität bis hin zu Leadership- und Transformation-Culture. CIOs, IT-Leiter:innen und Expert:innen konnten hier hands-on Best Practices austauschen, Herausforderungen aus dem Unternehmensalltag diskutieren und gemeinsam Lösungsansätze entwickeln.

Viele Sessions folgten dem Prinzip „Learning by Doing“ - mit Case Studies, Expert-Lounges, Live-Demos und moderierten Diskussionsformaten. Dadurch entstand eine Atmosphäre, in der Wissen nicht nur vermittelt, sondern gemeinsam weiterentwickelt wurde. Eine Teilnehmerin sagte: „In den Workshops konnte man das Gehörte unmittelbar in den eigenen Kontext übertragen - ein echter Mehrwert für alle, die Veränderung nicht nur verstehen, sondern gestalten wollen.“
Die Breakouts ergänzten so den Kongress perfekt: Sie boten Raum für Vertiefung, Vernetzung und konkrete Umsetzungsschritte – und machten deutlich, dass die Zukunft von IT und Leadership dort entsteht, wo Wissen in Handlung übergeht.

Ethik trifft Effizienz: vom Buzzword zur Umsetzung
Am Abend sorgte Gerhard Kürner (506.ai) für die dringend nötige Erdung. Seine Diagnose: Viele Unternehmen reden über KI, aber kaum eines wendet sie sinnvoll an: „Wir brauchen nicht noch mehr KI-Strategien, sondern endlich funktionierende KI-Use-Cases.“
Seine Botschaft war deutlich: Exzellenz in KI ist keine Frage der Technologie, sondern der Umsetzungstiefe – und damit der Unternehmenskultur.
Daran knüpfte Jürgen Bogner (Bitme.digital) in seiner Keynote „Dark Patterns, Bright Minds“ an. Er warnte vor unethischen Designmustern, die in automatisierten Systemen längst unsichtbar wirken: „Nur wer die dunklen Muster kennt, kann die hellen Momente der KI gestalten.“
Beide Redner zeigten: Ethik ist kein moralischer Luxus, sondern ein Designprinzip. Verantwortungsvolle Technologie entsteht dort, wo Führung bereit ist, nicht nur auf Effizienz, sondern auch auf Integrität zu optimieren.
Auch abseits der Bühnen herrschte am ersten Kongresstag-Abend beste Stimmung. Bei guter Musik nutzten die Teilnehmer:innen die Gelegenheit, sich bei regionalen Spezialitäten und guten Gesprächen zu vernetzen.

Führung als Bewusstseinsarbeit
Der zweite Kongresstag stand im Zeichen des Menschen hinter der Technologie. Sabine Gromer (Magnolia Tree) sprach über „Emotional Agility“ - die Fähigkeit, in unsicheren Zeiten beweglich zu bleiben, ohne die eigene Haltung zu verlieren. „In Zeiten von KI wird Empathie zum strategischen Vorteil.“ Was zunächst weich klingt, entpuppte sich als harte Führungsanforderung. Denn je digitaler Organisationen werden, desto größer wird die Notwendigkeit, emotionale Kompetenz systematisch zu entwickeln.
Der humanoide Roboter G1 sorgte für Staunen im Publikum. In einer kurzen Live-Demonstration zeigte G1, wie natürlich KI-gestützte Dialoge und Bewegung inzwischen wirken können.
Nadine Rass (Respire), ehemalige Profisportlerin, übersetzte diesen Gedanken in ein Leadership-Mantra: „Gesunde Führung beginnt mit Selbstführung.“ Damit verschob sich der Fokus von Technik auf Psyche - ein Trend, der in vielen CIO-Organisationen noch kaum angekommen ist, aber über Erfolg oder Burnout ganzer Teams entscheidet.
Markus Reisner (Österreichisches Bundesheer) verband Geopolitik mit Digitalisierung und machte deutlich, dass technologische Abhängigkeit längst sicherheitspolitische Dimensionen hat.„Im digitalen Schach gewinnt nicht der Schnellste, sondern der mit dem klarsten Plan.“ Er appellierte an CIOs, Technologie als Machtfaktor zu begreifen und Verantwortung für Stabilität und Werte im digitalen Raum zu übernehmen.
Die Panel-Diskussion "Digitale Souveränität, Macht & Verantwortung" bildete einen inhaltlichen Höhepunkt des zweiten Konferenztages.
Auf der Bühne diskutierten Martin Böhm, Dorit Bosch, Andreas Kodweiss, Stefan Kollinger, Herbert Lohninger und Florian Kurzmaier. Das Panel behandelte die Frage, wie Organisationen im Spannungsfeld zwischen technologischer Abhängigkeit und strategischer Autonomie agieren können.

Die Diskussion begann mit der Begriffsdefinition: Digitale Souveränität bedeutet Handlungsfähigkeit - die Möglichkeit, im digitalen Raum selbstständig zu handeln. Damit war der Tenor gesetzt: Es ging nicht um politische Parolen, sondern um operative Entscheidungsfreiheit - etwa bei Cloud-Infrastrukturen, Datenhaltung und Open-Source-Strategien.
Zentrale Botschaft: Europa braucht gemeinsame Standards und Kompetenzen, um Innovation nicht durch Regulierungsangst auszubremsen. Besonders betont wurde die Notwendigkeit einer europäischen Deklaration für digitale Souveränität, die bis Jahresende 2025 verabschiedet werden soll.
Vanessa Langhammer zeigte im Interview, dass moderne IT-Führung nicht über Kontrolle, sondern über Vertrauen funktioniert. Sie forderte, das Ego aus Führungsprozessen zu nehmen und stattdessen Wirkung durch Klarheit, Empathie und Selbstreflexion zu erzeugen.
Und Fred Luks, Nachhaltigkeitsexperte, zog die Linie zur Wirtschaftsethik: „Haltung ist die neue Strategie.“ Damit wurde klar: Die Zukunft der IT-Führung liegt weniger in technischen Skills als in mentaler Resilienz - der Fähigkeit, mit Unsicherheit konstruktiv umzugehen.
Am Abend sorgte das Oktoberfest in Dirndl und Lederhose für ausgelassene Atmosphäre - ein gelungener Brückenschlag zwischen Business und Begegnung. Die Stimmung war entspannt, herzlich und zeigte: Innovation gelingt am besten dort, wo Menschen miteinander ins Gespräch kommen.

Wirtschaft, Wahrheit und Wirklichkeit
Am dritten Kongresstag wurden diese Überlegungen auf die makroökonomische Ebene gehoben.
Stefan Bruckbauer (UniCredit Bank Austria) zeichnete ein realistisches Bild der Wirtschaftslage: „Wachstum braucht Vertrauen und das ist keine Software.“
Vertrauen, so der Tenor, ist die unsichtbare Infrastruktur jeder digitalen Transformation - sowohl in Teams als auch in Märkten.
Hermann Kaineder (HAI) ergänzte, dass echte Digitalisierung dort beginnt, wo Lernen Teil des Arbeitsalltags wird: „Digitalisierung passiert nicht in Tools, sondern in Köpfen.“
Anschließend gab es eine Podiumsdiskussion mit Martin Dusek-Lippach (Wiener Linien), Heimo Kern (Neuroth International), Ekkehard Preis (Erste Digital), Karin Zehetbauer (A1) und Alexander Hohnjec (KANTIG).
Sie thematisierte die Frage, wie weit Organisationen in ihrer Transformationsfähigkeit gehen können, bevor sie an strukturellen oder kulturellen Grenzen stoßen.
Moderator Alexander Hohnjec eröffnete mit den Worten: „Transformation heißt nicht, alles zu zerstören, sondern das System zu dehnen, bis es Neues zulässt.“ Im Fazit stand die Erkenntnis: Transformation am Limit verlangt Resilienz, Priorisierung und Mut zur Unvollkommenheit – sowie eine neue Art von Führung, die Stabilität nicht als Gegensatz zu Veränderung versteht.
Martin Mair forderte, Projekte weniger zu planen und mehr zu tun. Er zeigte, dass Fortschritt nicht aus Perfektion, sondern aus konsequentem Handeln entsteht. „Machen ist die ehrlichste Form von Innovation.“
Sein Aufruf zum Mut zur Umsetzung machte deutlich, dass Transformation nur gelingt, wenn Organisationen den Schritt vom Denken ins Tun wagen.

Für den emotionalen Schlusspunkt sorgte Armin Wolf (ORF) mit seiner journalistischen Keynote: „Realität ist kein Algorithmus, sondern eine Verantwortung.“ Er erinnerte daran, dass die größte Herausforderung im KI-Zeitalter nicht technischer, sondern gesellschaftlicher Natur ist: Wie sichern wir Wahrheit in einer Welt synthetischer Realität?
Von der Technik zur Haltung
Im Closing mit Martina Kruber, Lisa Höllbacher und Reinhard Gussmagg verdichtete sich, was den Kongress prägte: Digitalisierung ist kein Event, sondern eine Kulturarbeit: „Veränderung ist kein Projekt – sie ist unser Alltag.“
Das Publikum nahm mehr mit als nur neue Begriffe. Es ging um eine neue Haltung. Der CIO der Zukunft ist kein Infrastrukturmanager, sondern ein kultureller Architekt. Er führt nicht Maschinen, sondern Menschen – und sorgt dafür, dass Technologie Sinn behält.
Der CIO Kongress 2025 hat gezeigt: Die wahre Disruption der Digitalisierung ist der Mensch selbst.

Der CIO Kongress 2025 hat die Debatte um IT-Führung neu kalibriert.
Statt über Frameworks oder Architekturen zu sprechen, diskutierten Führungskräfte über Mut, Ethik und Realität – die neuen Kernressourcen einer nachhaltigen digitalen Transformation.
In einer Zeit, in der Chatbots Code schreiben und KI-Prozesse steuert, bleibt der Mensch das einzige System, das Sinn versteht.
Schon jetzt für den CIO Kongress 2026 mit einem Early-Bird Ticket anmelden.