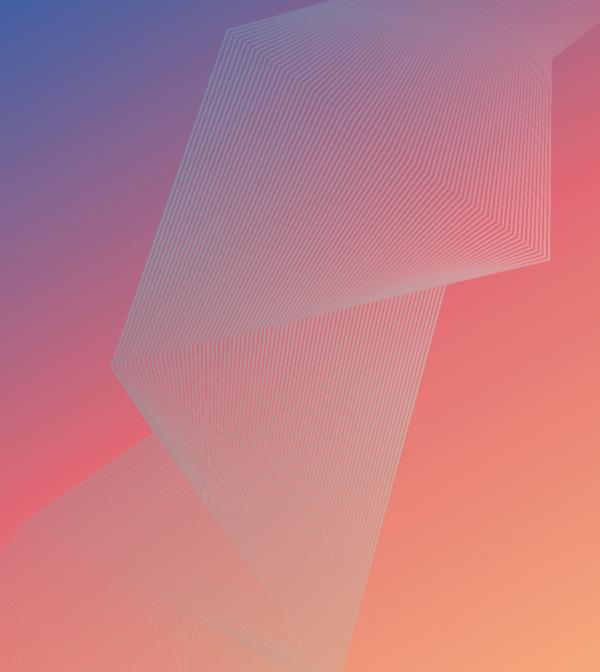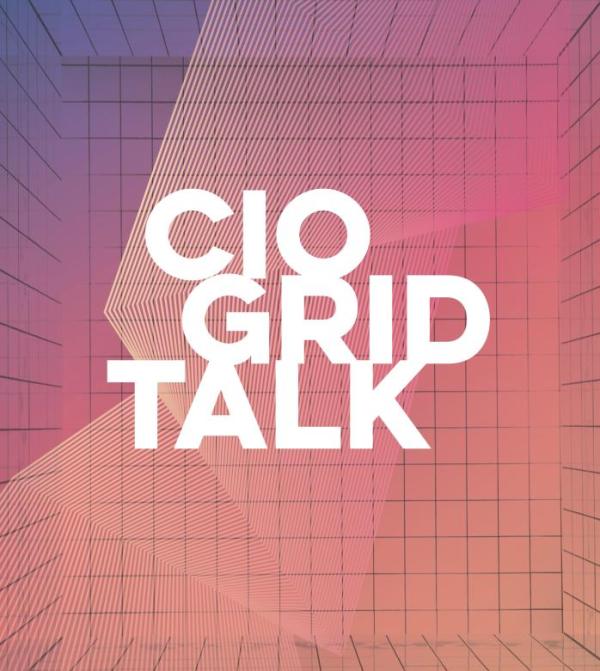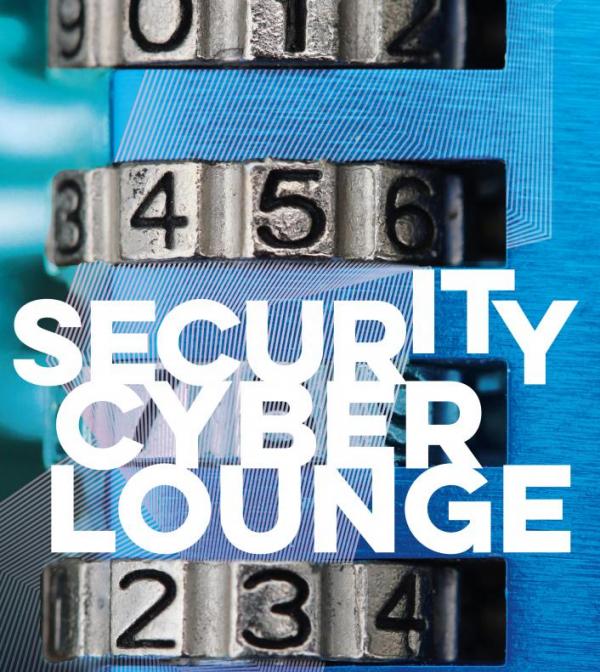Das Digitalministerium von Schleswig-Holstein meldet den ersten großen Meilenstein seiner Open-Source-Strategie. Das Ziel: ein vollständig souveräner IT-Arbeitsplatz.
"Wir wollen unabhängig werden von großen Tech-Konzernen und die digitale Souveränität sicherstellen“, sagt Schleswig-Holsteins Digitalminister Dirk Schrödter zum bisher größten Open-Source-Projekt des Landes. In einem sechsmonatigen Prozess hat die Landesverwaltung die Migration des gesamten E-Mail-Systems von Microsoft Exchange und Outlook auf die Open-Source-Lösungen Open-Xchange und Thunderbird gestemmt.
Betroffen waren rund 40.000 Postfächer mit mehr als 100 Millionen E-Mails und Kalendereinträgen. Von der Staatskanzlei und den Ministerien über Justiz und Landespolizei bis hin zu weiteren Landesbehörden – rund 30.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hätten sich gemeinsam auf einen neuen Weg gemacht, so der Minister. Schleswig-Holstein sei damit dem Ziel eines digital souveränen IT-Arbeitsplatzes ein großes Stück nähergekommen.
Wie in vielen großen IT-Projekten gab es auch bei der Migration des Mail-Systems einige Probleme und Verzögerungen, wie Schrödter zuvor einräumen musste. Doch er ließ sich davon nicht beirren: „Eine solche Umstellung ist keine Kleinigkeit. Wir sind echte Pioniere. Wir können nicht auf die Erfahrung anderer zurückgreifen – weltweit gibt es kaum ein vergleichbares Projekt dieser Größenordnung."
Die Migration ist ein zentraler Bestandteil der "Open Innovation und Open Source Strategie Schleswig-Holstein“, die weitere Veränderungen in der Landes-IT vorsieht. So soll die Software Nextcloud Schritt für Schritt Microsoft SharePoint als zentrale Plattform für Zusammenarbeit ersetzen. Für Videokonferenzen setzt das Land auf das quelloffene System OpenTalk. Ähnliches ist für die Telefonsysteme geplant. Langfristig wollen die Norddeutschen auf allen Rechnern das Betriebssystem Windows durch Open-Source-Alternativen wie Linux ersetzen.
Schrödter betont zudem die Bedeutung der Strategie über das Bundesland hinaus: „Künftig können wir mit unseren Erfahrungswerten von der Datenanalyse bis zum Monitoring im Rechenzentrum anderen helfen und sie unterstützen, wenn sie sich auf den Weg machen, den wir gerade als erste beschreiten."
Ob die Initiative am Ende wirklich als Vorbild für andere Bereiche im Public Sector taugt, muss sich erst noch erweisen. Schließlich gab es in der Vergangenheit auch gescheiterte Open-Source-Großprojekte, die es in die Schlagzeilen schafften. Viele dürften sich noch an das „LiMux“-Projekt der Stadt München erinnern, das 2003 mit einem ähnlichen Ziel an den Start ging und 2017 mit einer Rückkehr zu Microsoft-Systemen endete. Neben technischen und organisatorischen Problemen spielte damals auch die kritische Haltung des 2014 neu gewählten Stadtrats eine Rolle.
Heute ist die Ausgangssituation eine andere. Das Thema digitale Souveränität hat massiv an Bedeutung gewonnen und wird breit diskutiert. Selbst bisher kritische PolitikerInnen sehen in Open-Source-Software einen Weg, die Abhängigkeit von übermächtigen IT-Konzernen zu verringern. Last, but not least treibt auch Digitalminister Karsten Wildberger die Entwicklung voran und probiert im eigenen Haus quelloffene Systeme aus. Mit anderen Worten: Das Momentum für Open-Source-Migrationen in der öffentlichen Hand war nie besser.
Fotocredit: Shutterstock/Milan Adzic