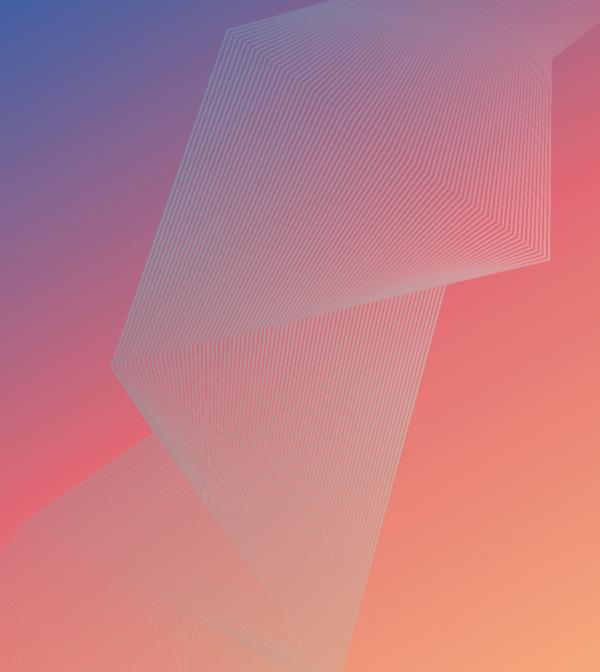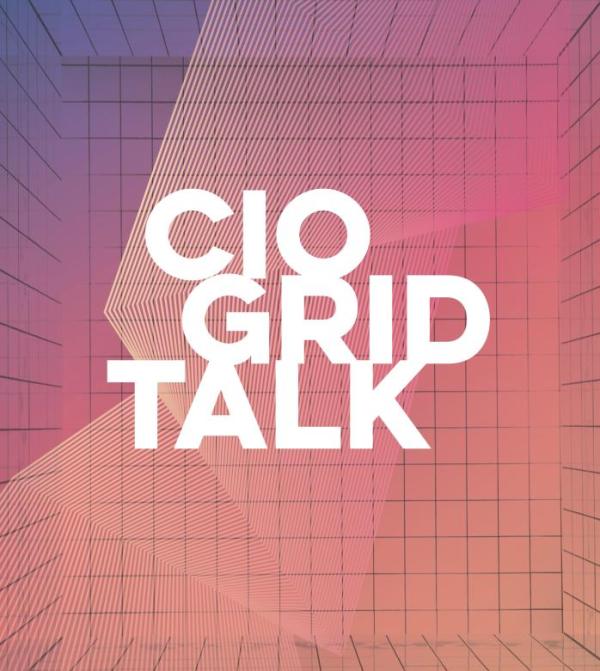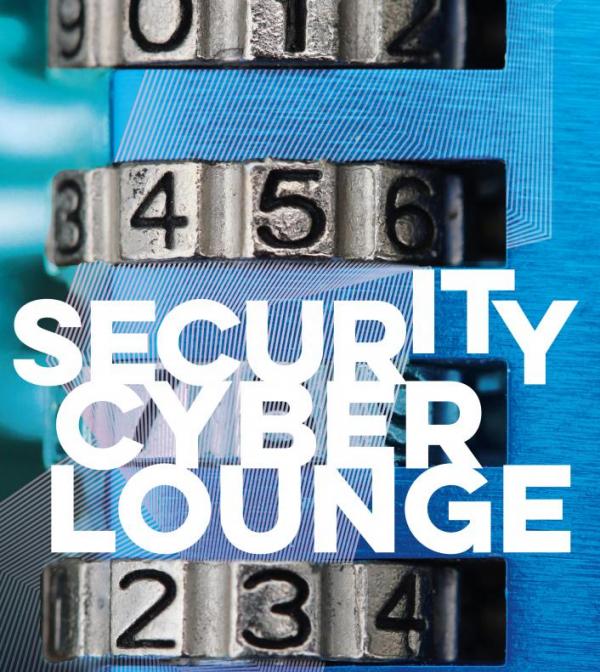Tech Trendscout Kolumne von Lisa Höllbacher
Als Tech Scout und KI-Beraterin bewege ich mich tagtäglich an der Schnittstelle zwischen Hightech und Mensch. Ich sehe, wie generative KI Inhalte erschafft, Texte schreibt, Codes generiert, Designs entwirft – in einer Geschwindigkeit und Qualität, die für viele von uns vor wenigen Jahren noch unvorstellbar war. Und je mehr ich erlebe, was KI kann, desto intensiver beschäftigt mich eine Frage: Was bleibt eigentlich von uns?
Geoffrey Hintons Weckruf In einem eindrücklichen Spotify-Interview ("I Tried to Warn Them…") – spricht Geoffrey Hinton, oft als "Godfather of AI" bezeichnet, über die potenziell tödlichen Gefahren von KI. Besonders bleibt eine seiner Aussagen hängen: Er räumt eine reale 20-prozentige Wahrscheinlichkeit ein, dass KI uns überflüssig machen könnte. Es ist kein dystopischer Alarmismus, sondern die Einschätzung eines Mannes, der Jahrzehnte an der Spitze der KI-Entwicklung stand.
Hinton nennt es ein "Wettrüsten" zwischen Unternehmensinteressen und Kontrollinstanzen. Was uns als Gesellschaft bleibt, ist ein kollektives Innehalten. Nicht, um Innovation zu bremsen, sondern um zu reflektieren, welche menschlichen Qualitäten wir aktiv stärken müssen, wenn Maschinen uns in Logik, Geschwindigkeit und Verarbeitungskraft überholen.
Doch Hintons Warnung greift tiefer: Sie konfrontiert uns mit der ethischen Frage, wie viel Kontrolle wir bereit sind, an Systeme abzugeben, deren Entscheidungswege wir oft nicht mehr nachvollziehen können. Was bedeutet es, wenn KI-Systeme nicht nur mit uns, sondern über uns entscheiden? In Bereichen wie Justiz, Medizin oder Personalwesen ist das keine Zukunftsmusik, sondern gelebte Gegenwart.
Die größte Gefahr liegt vielleicht nicht in einer allmächtigen Superintelligenz, sondern in der schleichenden Verschiebung von Verantwortung. Wenn wir uns zu sehr auf KI verlassen, verlieren wir nicht nur Kompetenzen und trainierte Fähigkeiten, sondern auch moralisches Urteilsvermögen. Entscheidungen werden dann aus Effizienzgründen delegiert – nicht weil es sinnvoll ist, sondern weil es möglich ist.
Gerade deshalb brauchen wir klare ethische Leitplanken und eine breite gesellschaftliche Debatte: Welche Aufgaben wollen wir KI überlassen? Welche Werte sollen in Algorithmen einfließen? Und wie können wir sicherstellen, dass Technologie unsere Demokratie stärkt – und nicht untergräbt?
Die Verantwortung liegt nicht nur bei Entwickler:innen, sondern auch bei Unternehmen, Bildungseinrichtungen und jeder einzelnen Nutzer:in. Wir alle gestalten die Zukunft dieser Technologie mit – bewusst oder unbewusst. Und je bewusster wir uns unserer Rolle und Verantwortung werden, desto größer ist die Chance, dass KI nicht entmenschlicht, sondern Menschlichkeit ermöglicht.
Die Wiederentdeckung des Menschlichen
Je intelligenter die Maschinen, desto bedeutsamer wird das Menschliche. Nicht im Sinne von Leistung, sondern in Form von Empathie, Kontextverständnis, Ethik, Kreativität, Sinn. In meiner Arbeit sehe ich oft, wie Projekte genau daran scheitern: nicht am Modell, sondern am Menschen. An fehlender Kommunikation, Überforderung, Missverständnissen – oder schlicht daran, dass niemand gefragt hat: "Fühlt sich das für die Nutzer:innen richtig an?"
Was Organisationen jetzt tun können
Es braucht neue Skills und Formate. Nicht nur Prompt Engineering, sondern auch kritisches Denken, Perspektivenvielfalt, ethisches Bewusstsein. Und es braucht Mut, Menschlichkeit nicht als Nebensache zu behandeln, sondern als Kernkompetenz. Was ich empfehle:
- In Workshops setze ich auf kombinierte Formate: KI-Verständnis trifft auf Selbstreflexion.
- Achtsamkeit in Tech-Projekten? Unbedingt. Denn nur wer sich selbst spürt, kann verantwortungsvoll gestalten.
- Co-Creation mit Betroffenen: Nutzer:innen frühzeitig einbinden, Fragen stellen, zuhören.
- Kreativität fördern: Die besten Ideen entstehen nicht aus Algorithmen, sondern aus Irritation, Widerspruch und Emotion.
Fazit: Was bleibt von uns?
Vielleicht ist genau das die große Chance: Während KI uns in vielen Bereichen übertrifft, zwingt sie uns, uns selbst neu zu entdecken. Unsere Stärken zu erkennen, die kein neuronales Netz abbilden kann. Menschlichkeit ist kein Auslaufmodell – sie ist das Upgrade, das wir brauchen.
Geoffrey Hintons eindringlicher Appell endet sinngemäß mit einer Frage: "Wenn Maschinen alles besser können – was ist dann noch unsere Rolle?" Meine Antwort: Unsere Rolle ist nicht, mitzuhalten, sondern sinnstiftend zu gestalten. KI nimmt uns Arbeit ab. Aber Menschlichkeit bleibt unsere Aufgabe. Mehr denn je.