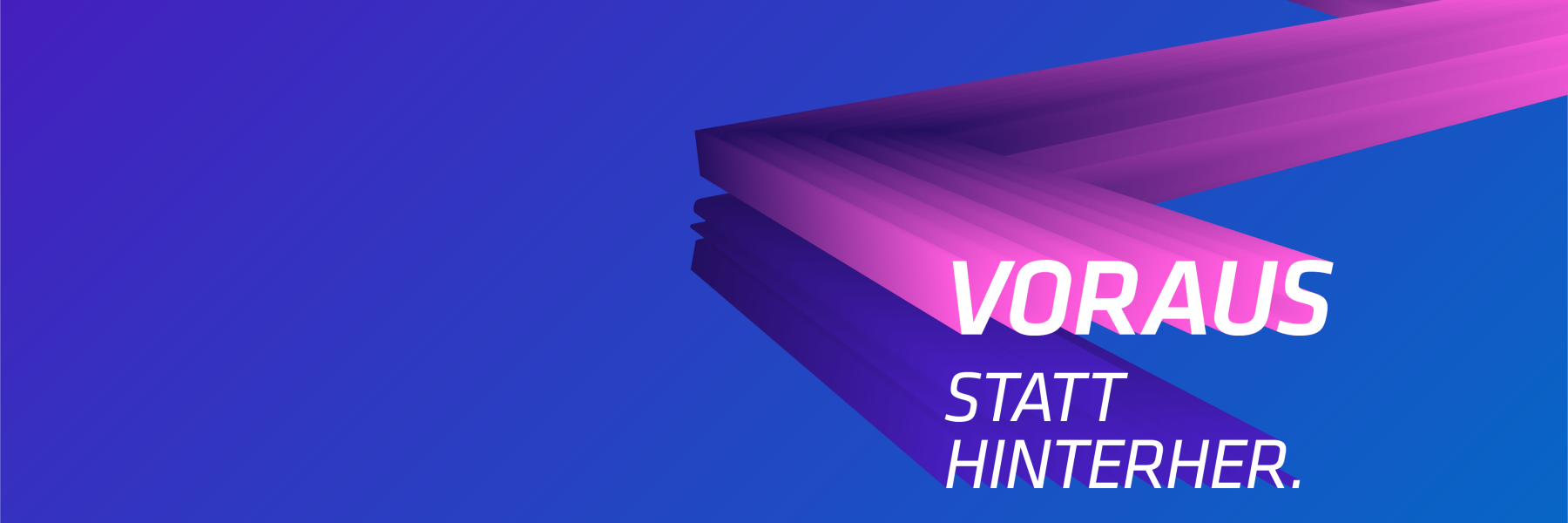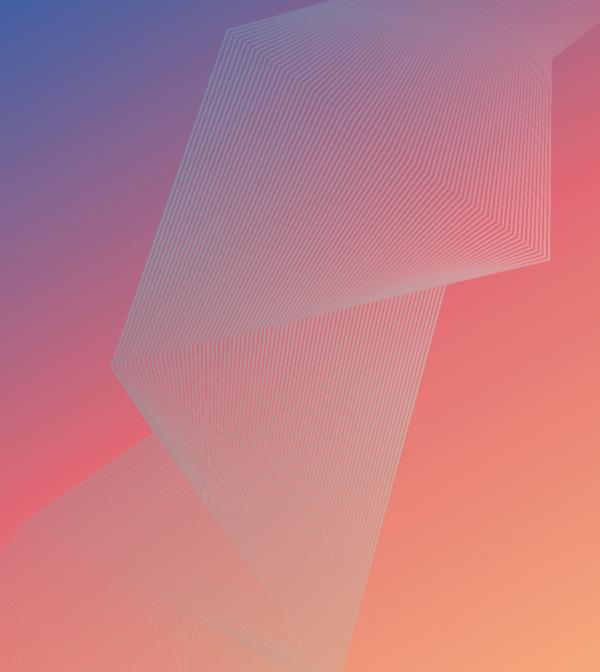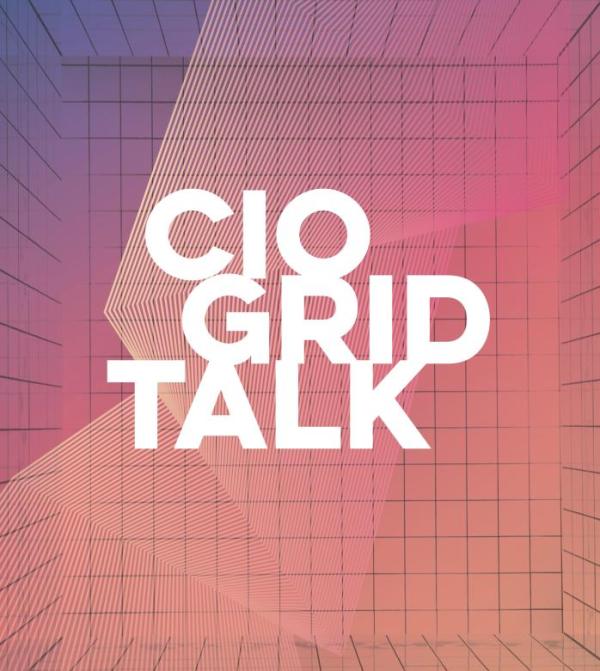Wie Sie Souveränität und Wettbewerbsvorteile in der Softwareentwicklung schaffen.
Standard-Features implementieren, Support-Tickets bearbeiten, Fehler suchen und beheben, Dokumentationen erstellen – viele Arbeiten im Bereich der Softwareentwicklung (SWE) sind Routinetätigkeiten. Für Entwickler:innen sind sie nur mäßig spannend, weil sie kaum Abwechslung und Herausforderung bieten. Für KI-gestützte Tools hingegen sind sie mit ihren klaren Strukturen und Regeln ideal geeignet. Die Tools können solche wiederkehrenden Aufgaben zuverlässig erledigen und den Entwickler:innen damit Freiräume für das kreative Lösen komplexer Problemstellungen – etwa bei der Konzeption und Umsetzung von Anwendungsarchitekturen – verschaffen.
Noch wird beim GenAI-Einsatz in der Softwareentwicklung viel experimentiert. Doch nach Erfahrungen aus unzähligen Entwicklungsprojekten zeigt sich, dass folgende Aspekte für den Erfolg entscheidend sind:
- Auf das Anwendungswissen kommt es an: Entwickler:innen benötigen umfangreiches Wissen über Geschäftsmodelle, Branchenbesonderheiten, die internen Prozesse und die konkreten Herausforderungen der künftigen Nutzer im Arbeitsalltag. Das wird umso wichtiger, je mehr Routineaufgaben sie an GenAI-Tools auslagern, damit sie den Tools genaue Anweisungen geben können und die Ergebnisse keine großen Nacharbeiten erfordern.
- Integration ist entscheidend: GenAI-Tools brauchen Zugriff auf bestehende Systeme und müssen sich nahtlos in etablierte Prozesse und Compliance-Strukturen einfügen. Deshalb müssen Entwickler:innen einen Architekturrahmen vorgeben, der die notwendigen Integrationen regelt – andernfalls können die Tools ihr enormes Potenzial nicht ausspielen.
- Transparenz schafft Vertrauen: GenAI-Lösungen bergen Unsicherheiten – nicht immer ist beispielsweise klar, ob ausreichend Daten in der benötigten Qualität bereitstehen und wie gut die Ergebnisse sind. In Abhängigkeit von der Modellversion, der Datenqualität und sogar vom Prompt können die Ergebnisse stark variieren. Entwickler:innen müssen diese Unsicherheiten kennen und offen mit ihnen umgehen, um GenAI effektiv als Helfer nutzen zu können.
- Interdisziplinäre Zusammenarbeit ist ein Schlüsselfaktor: Die besten Ideen und Lösungen entstehen erfahrungsgemäß dort, wo Menschen mit unterschiedlichen Perspektiven zusammenarbeiten – das gilt auch für die Softwareentwicklung. Um GenAI optimal in Entwicklungsprojekten einzusetzen, müssen Entwickler:innen das Know-how und die Erfahrung, aber auch die Anforderungen aus Fachbereichen, von UX-Designern, Vertrieblern und Compliance-Experten berücksichtigen.
Um diese entscheidenden Aspekte in der Praxis zu realisieren und das volle Potenzial KI-gestützter SWE auszuschöpfen, bedarf es einer klaren strategischen Herangehensweise, die über die bloße Implementierung von Tools hinausgeht und den gesamten Lebenszyklus der SWE umfasst. Nur so wird sichergestellt, dass KI nicht nur als kurzfristiger Effizienztreiber, sondern als nachhaltiger Enabler wirkt.
Strategischer Fahrplan zur KI-gestützten Softwareentwicklung
Der Weg zur KI-gestützten SWE erfordert eine strukturierte Herangehensweise. Es genügt nicht, einzelne Tools einzuführen; vielmehr muss der gesamte Prozess betrachtet und angepasst werden, denn hinter SWE steckt nicht nur das reine Entwickeln.
- Projektmanagement: KI unterstützt intelligente Projektplanung, Risikomanagement, Priorisierung und Ressourcenoptimierung.
- Anforderungsmanagement: KI hilft bei der Analyse, Dokumentation und Validierung von Anforderungen, um Klarheit und Vollständigkeit zu gewährleisten.
- Entwicklung: KI ist an der Codegenerierung beteiligt, erleichtert Code-Reviews, automatisiert die Dokumentation und optimiert Code für Leistung und Effizienz.
- Testen: KI unterstützt die Erstellung von Testfällen, verbessert die Testautomatisierung und ermöglicht prädiktives Testen zur frühzeitigen Erkennung potenzieller Probleme.
Zunächst sind eine fundierte Standortbestimmung und Reifegradanalyse unerlässlich. Bevor man blindlings in neue Technologien investiert, gilt es, die aktuelle Ausgangslage systematisch zu analysieren.
- Wo stehen wir?
- Welche messbaren KPIs möchte ich erreichen?
- Wo soll meine Lösung laufen (Cloud, Lokal, Hybrid)?
- Wie ist die aktuelle Tool-Landschaft beschaffen?
Diese Analyse hilft, den Reifegrad für den KI-Einsatz zu bewerten und über die KPIs konkrete nächste Schritte abzuleiten. Es geht darum, strategische Empfehlungen zu definieren und eine gemeinsame Vision & Zielbild festzulegen, die eine solide Entscheidungsgrundlage für Investitionen bilden und Risiken minimieren.
Darauf aufbauend sollte eine Potenzialanalyse und Use-Case-Identifikation erfolgen. Hierbei werden die größten Hebel für den Einsatz von KI entlang des Softwareentwicklungsprozesses identifiziert. Entscheidend ist eine Bewertung nach Aufwand, Nutzen und Kritikalität, um sich auf die relevantesten Einsatzfelder zu konzentrieren und Use Cases mit hohem Umsetzungspotenzial zu entwickeln.
Die Auswahl geeigneter Technologien und Tools ist ein weiterer kritischer Schritt. Die Evolution der KI-Unterstützung in der SWE hat bereits verschiedene Phasen durchlaufen: von frühen Chatbots über aktuell gängige Copilot-Systeme, die eine teilweise Integration von KI in Entwicklungsumgebungen ermöglichen (z.B. GitHub Copilot), bis hin zu fortschrittlichen KI-Plattformen mit Agenten (z.B. Cursor, Roo). Diese Plattformen bieten vollintegrierte KI-Funktionalitäten, die oft durch autonome Agenten-Systeme ermöglicht werden. Gerade bei bereits gut validierten Anwendungsfällen, wie dem Einsatz als Coding Assistant, empfiehlt es sich, frühzeitig - z.B. während der vorherigen Phase - in eine Proof-of-Value-Phase zu starten, um frühzeitig die Erfahrungen der Entwickler:innen in die Bewertung miteinfließen zu lassen.
Ein nicht zu unterschätzender Aspekt ist die Qualifizierung und Befähigung der Mitarbeiter:innen. Die Einführung von KI in der SWE verändert auch die Rollen und erfordert neue Kompetenzen. Während traditionelle Programmierkenntnisse weiterhin gefragt sind, erfordert die Zukunft ausgeprägte analytische Fähigkeiten, kritisches Denken und Kommunikationsfähigkeiten, um effektiv mit KI-Systemen zu interagieren und diese zu steuern. „Prompt Engineering“ wird zu einer Kernkompetenz, die es Entwickler:innen ermöglicht, präzisen, konformen und kontextuell passenden Code von der KI zu erhalten.
Schließlich darf die Einhaltung von Compliance und regulatorischen Rahmenbedingungen nicht außer Acht gelassen werden. Die rechtskonforme und ethisch verantwortliche Einführung von KI in regulierten Umfeldern ist von größter Bedeutung. Dies erfordert die Analyse regulatorischer Anforderungen (z.B. AI Act, DSGVO, Sektorregularien), die Prüfung bestehender Entwicklungsprozesse auf Compliance-Fähigkeit und Empfehlungen zur Anpassung von Governance, Prozessen und Dokumentation.
Ein strategischer Ansatz für KI bedeutet über die aktuellen, eher grundlegenden „Copilot“-Funktionalitäten hinauszublicken und das transformativere Potenzial von KI-Plattformen und autonomen Agenten zu nutzen. Diese fortschrittlichen Systeme können komplexere, mehrstufige Aufgaben mit größerer Autonomie bewältigen, was zu tiefergehenden Effizienzsteigerungen führt und möglicherweise völlig neue Paradigmen für die Entwicklung, Wartung und Weiterentwicklung von Software ermöglicht. Dies erfordert eine vorausschauende Strategie, die nicht nur in einzelne KI-Tools investiert, sondern auch in die grundlegenden Fähigkeiten, die für die Integration, Verwaltung und Sicherung dieser fortschrittlichen Systeme erforderlich sind. Dies signalisiert einen Wandel von KI als bloßem Werkzeug zu KI als aktivem, integriertem Teilnehmer im Entwicklungslebenszyklus.
Kontrolle statt Abhängigkeit: Die Bedeutung von KI-Souveränität
In der Diskussion um den Einsatz generativer KI, insbesondere in sensiblen Bereichen wie dem öffentlichen Sektor, gewinnt das Thema Souveränität zunehmend an Bedeutung. Es geht darum, die Fähigkeit zu bewahren, autonom handeln zu können und nicht in eine unerwünschte Abhängigkeit von einzelnen Anbietern zu geraten. Die adesso GenAI Impact Report Österreich zeigt, dass für 66% der Unternehmen die Herkunft von GenAI-Anwendungen, also ob sie beispielsweise in der EU entwickelt wurden, sehr wichtig oder wichtig ist. Dies unterstreicht eine wachsende Nachfrage nach „KI Made in EU“ und positioniert souveräne KI als zentrales Thema im aktuellen Gartner KI-Hype Cycle. Souveränität wird hierbei als die Fähigkeit definiert, autonom zu handeln und selbstbestimmt zu entscheiden.
Diese Entwicklung wird von einer Vielzahl von Faktoren angetrieben. Geopolitische Risiken, wie Handelskonflikte oder Vergeltungsmaßnahmen, können sich auf die digitale Infrastruktur auswirken. Gleichzeitig ist die Kontrolle über sensible Daten nicht verhandelbar, insbesondere im Hinblick auf Datenschutzgesetze und den Schutz von IP-Rechten.
Souverän ja, aber wie?
Bei der Bereitstellung von GenAI-Lösungen zeigen Unternehmen eine klare Präferenz für flexible Infrastrukturmodelle. 39% der Unternehmen verfolgen laut GenAI Impact Report einen hybriden Ansatz, der Cloud- und On-Premise-Lösungen kombiniert. Ein ebenso hoher Anteil von 39% setzt ausschließlich auf On-Premise-Lösungen, während 21% rein Cloud-basierte GenAI-Anwendungen nutzen.
Die Analyse von souveränen GenAI-Stacks konzentriert sich auf drei Faktoren:
- Der Zugang zu KI-Hardware kann über verschiedene Wege erfolgen: Hyperscaler bieten unübertroffene Skalierbarkeit (z.B. Azure, AWS, Google Cloud), während souveräne Cloud-Optionen (z.B. StackIT, Ionos, adesso business cloud) und On-Premise-Lösungen (z.B. Dell, Nvidia, HPE) die Kontrolle und Datensensibilität in den Vordergrund stellen.
Ein hybrider Ansatz stellt einen pragmatischen und strategischen Kompromiss dar. Er ermöglicht es, die Vorteile der Cloud, wie Skalierbarkeit und Zugang zu modernsten Modellen und GPU-Ressourcen, für weniger sensible Workloads oder das Modelltraining zu nutzen, während hochsensible Daten und kritische Anwendungen On-Premise oder in vertrauenswürdigen souveränen Cloud-Umgebungen verbleiben.
- KI-Modell-Sektor (Foundation Models): Die wachsende Verbreitung und Leistungsfähigkeit von Open Source-KI-Modellen verändert die strategische Landschaft für souveräne KI grundlegend. Diese Modelle bieten volle Transparenz in den Entwicklungsprozess und reduzieren die Abhängigkeit von einzelnen, proprietären Anbietern.
- Auch auf Ebene der Software-Komponenten im GenAI-Stack gibt es mittlerweile vielfältige Optionen von Hyperscalern, Closed-Source-Lösungen und Open Source, die einen vendor-agnostischen Aufbau ermöglichen, wenn auch teilweise mit erhöhter Komplexität.
Fazit
KI wird Programmierer:innen nicht ersetzen, aber jemand, der KI nutzt, wird effizienter sein. Die KI übernimmt repetitive Aufgaben und unterstützt bei der Ideenfindung; der Mensch kontrolliert, evaluiert, korrigiert und ordnet die Ergebnisse fachlich ein. Diese Synergie, gepaart mit einer strategischen Implementierung, ist der Schlüssel, um die Effizienz der Softwareentwicklung zu steigern und Innovationen voranzutreiben. Es geht darum, der KI die langweiligen Aufgaben zu überlassen, damit wir uns auf die wirklich interessanten Dinge konzentrieren können.