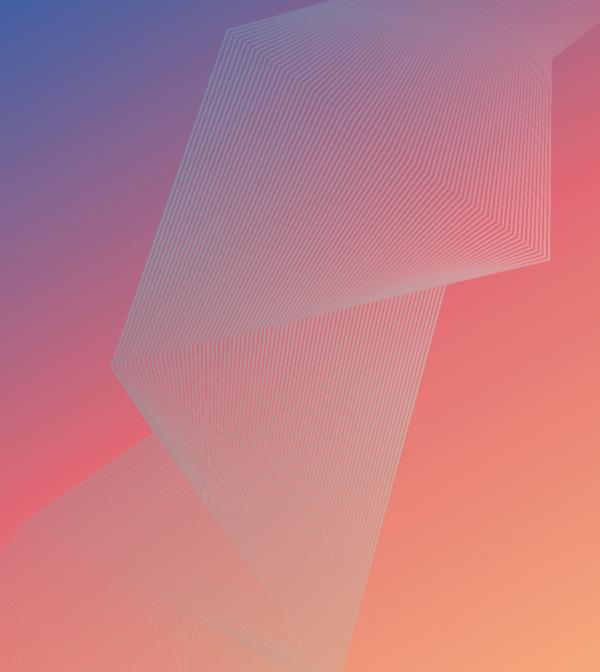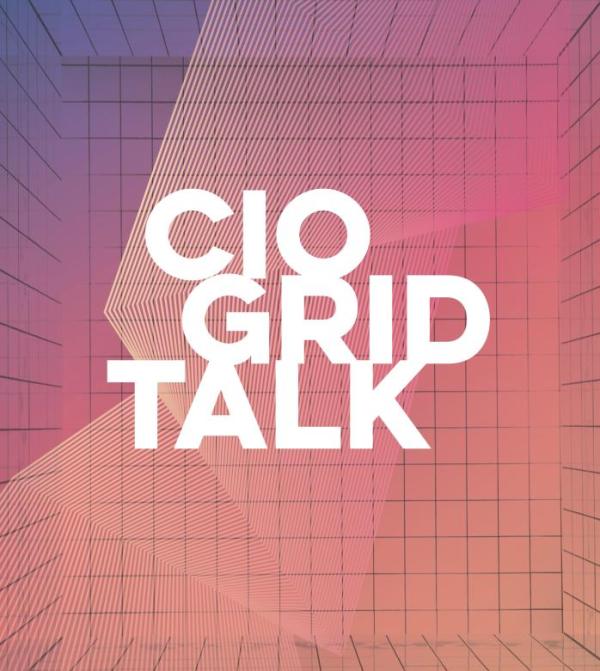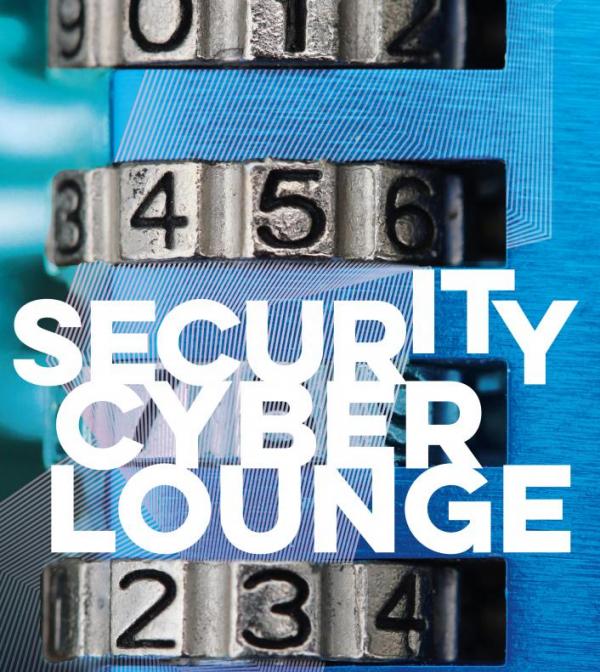Wenn Forscher:innen des Fraunhofer IPA Stuttgart beim CIO-Kongress goes WEST in Vorarlberg einen humanoiden Roboter live demonstrieren, ist das mehr als technisches Staunen. Es ist eine Einladung zur kritischen Reflexion: Wie viel „Mensch“ braucht Technologie – und wie viel Autonomie verträgt sie?
Dabei ist der Live-Auftritt ein Ausblick – kein Versprechen. Denn so klar wie das technische Potenzial ist auch die nüchterne Einschätzung des Instituts: „Frühestens 2026 rechnen wir mit ersten industriell wirklich einsetzbaren humanoiden Robotern.“ Der Engpass? Nicht die Hardware. Sondern die Daten. Trotzdem sollte man sich schon jetzt mit humanoiden Robotern anfreunden und die Berührungsängste verlieren.

Humanoide Roboter sind nur so gut wie das
Wissen, das sie trainiert und daran fehlt es
vielfach. Bewegungsdaten, Prozesswissen,
Kontextinformationen: Ohne strukturierten,
maschinenlesbaren Input bleibt die schönste
Mechanik blind. Gerade in der Industrie sind
viele Produktionssysteme historisch gewachsen –
aber nicht KI-fähig dokumentiert.
Warum CIOs & Digital Executives jetzt handeln sollten
Laut Statistik Austria nutzen derzeit nur 20 % der Unternehmen in Österreich überhaupt KI-Anwendungen, und gerade einmal 7 % mehr als zwei Technologien parallel. Dabei wären verlässliche Datenstrukturen, automatisierte Datenflüsse und interoperable Systeme der Grundstein für jedes zukünftige Robotik-Projekt.
Das Fraunhofer IPA bringt es auf den Punkt: „Das Problem ist nicht, dass die Roboter nichts können – sondern dass sie nicht wissen, was sie tun sollen.“
Damit ist klar: Wer über humanoide Robotik nachdenkt, muss bei der Datenqualität ansetzen. Es geht nicht um KI-Modelle allein, sondern um die Fähigkeit, Prozesse maschinenverständlich abzubilden und die richtigen Daten zur Verfügung zu haben.

3 Facts, die man kennen sollte
Expert:innen erwarten, dass die Gesamtkosten eines spezialisierten, humanoiden Roboters bis 2028 auf das Niveau eines durchschnittlichen Industriearbeiters sinken werden. Das würde einen massiven Investitionsschub auslösen – vor allem in Logistik, Fertigung und Service – und den globalen Arbeitskräftemangel adressieren.
Die Integration physischer Roboterflotten in Unternehmensnetzwerke vervielfacht die Angriffsfläche. Bereits heute sind 65 Prozent der OT/IoT-Sicherheitsvorfälle auf autonome Systeme zurückzuführen – mit potenziell physischen Schäden an Infrastruktur oder Lieferkette. IT-Abteilungen müssen lernen, nicht nur Cyber-, sondern auch physische Sabotageakte zu antizipieren und abzusichern.
Weniger als zehn Prozent der IT-Abteilungen in traditionellen Unternehmen verfügen derzeit über Expertise in Robotik-Betriebssystemen wie ROS (Robot Operating System) oder der physischen Wartung KI-gesteuerter Systeme. Dieser RobotOps-Skillgap ist die zentrale Hürde bei der Skalierung von Pilotprojekten zur unternehmensweiten Implementierung.
Physical AI – Der Übergang von Bits zu Muskeln
Viele CIOs sind aktuell damit beschäftigt, Governance-Fragen rund um Large Language Models (LLMs) zu klären. Doch während Debatten um Prompts und Datenhoheit laufen, bahnt sich in der physischen Welt eine weitaus radikalere KI-Revolution an: Physical AI.
Es geht längst nicht mehr nur um Prozessautomatisierung auf dem Bildschirm, sondern um die Integration intelligenter, autonomer Systeme in reale Abläufe. Die zentrale Herausforderung der kommenden Jahre wird daher nicht die nächste Cloud-Migration sein, sondern das Management mobiler, lernender Roboterflotten im Betrieb. Die heutige IT-Infrastruktur, Sicherheitsarchitektur und Organisationskultur sind darauf kaum vorbereitet.

Die Kontroverse: Die größte Herausforderung für die IT im produzierenden Gewerbe in den nächsten drei Jahren wird nicht die nächste Cloud-Migration sein, sondern das Management einer laufenden, mobilen Flotte autonomer, lernender Arbeiter. Die aktuelle IT-Infrastruktur, Kultur und vor allem die Sicherheitsarchitektur sind darauf nicht vorbereitet. Wir diskutieren über DevOps und übersehen, dass wir dringend RobotOps benötigen. D Die Kluft zwischen theoretischer KI-Adoption und realer physischer Transformation wird zum strategischen Risiko.
3 Thesen für die IT-Strategie von morgen
1. Robotik ist kein IT-Thema – sondern ein Führungsproblem.
Roboter verändern Prozesse – aber noch stärker verändern sie Erwartungen: an Kommunikation, Kontrolle, Rollenverständnis. Wer in Automatisierung investiert, gestaltet nicht nur Technik, sondern auch Unternehmenskultur.
2. Je menschenähnlicher die Technik, desto klarer muss die Governance sein.
Schon einfache soziale Signale wie Sprache oder Gestik erzeugen Vertrauen – und potenzielle Missverständnisse. Die Rolle humanoider Systeme muss daher technisch, rechtlich und kulturell präzise definiert werden.
3. Die wahre Reife zeigt sich nicht in der Technik, sondern in der Organisation.
Technisch ist vieles möglich. Doch erst Unternehmen mit klaren Rollen, durchdachten Datenprozessen und offener Kommunikation holen das Potenzial aus KI und Robotik wirklich heraus.

Was jetzt zählt: Führung, Daten, Haltung
Was jetzt zählt: Führung, Daten, Haltung
Der Einsatz humanoider Robotik wird zur Standortfrage – technologisch und kulturell. Wer diese Systeme nicht nur als Showeffekt, sondern als strategischen Faktor versteht, muss jetzt Weichen stellen:
- Eine fundierte Datenstrategie entwickeln: Welche Prozessdaten fehlen? Wie können sie automatisiert erfasst und strukturiert werden?
- Relevante Use Cases priorisieren: Wo entsteht konkreter Mehrwert durch Robotik? Wo bleibt der Mensch unverzichtbar?
- Ethik und Kommunikation stärken: Welche Werte gelten im Umgang mit autonomen Systemen – und wie vermitteln wir das nach innen?
Ein Gedanke zum Mitnehmen
Humanoide Roboter sind kein Selbstzweck – aber auch kein Zukunftsschreck. Sie sind Spiegel und Stresstest für unsere digitale Reife.
Wer sie einsetzt, braucht mehr als moderne Technologie. Nämlich Klarheit im Ziel, Struktur in den Daten – und Haltung in der Führung.
Der humanoide Roboter des Fraunhofer IPA ist live beim LSZ CIO-Kongress WEST in Vorarlberg zu erleben – gemeinsam mit Expert:innen aus KI, Automation und Digital Leadership aus dem Westen Österreichs, der Schweiz, Deutschland und Liechtenstein.

Nutzen Sie die Gelegenheit, sich mit Menschen zu vernetzen, die nicht nur Technik implementieren – sondern Zukunft gestalten.