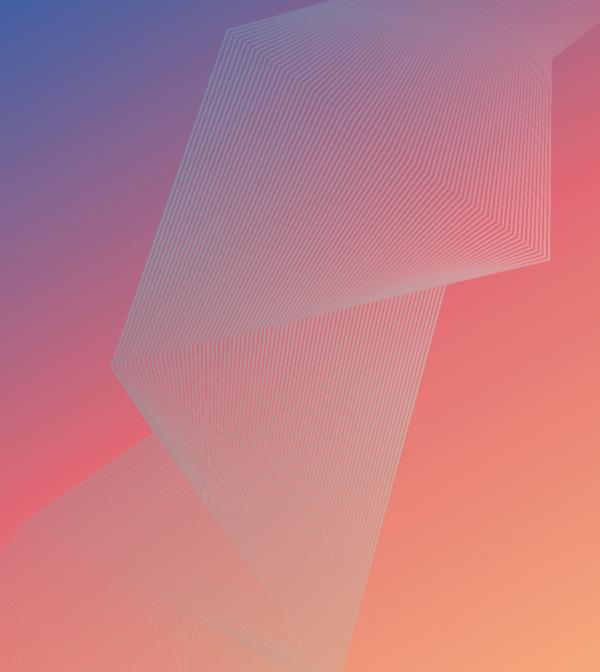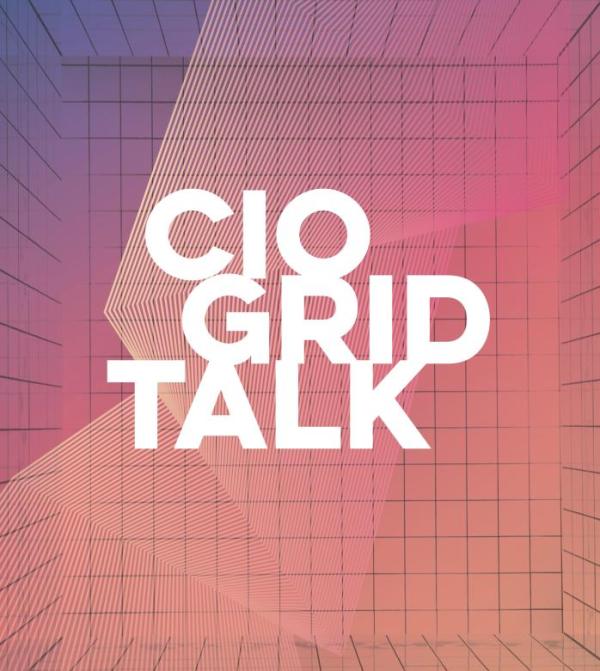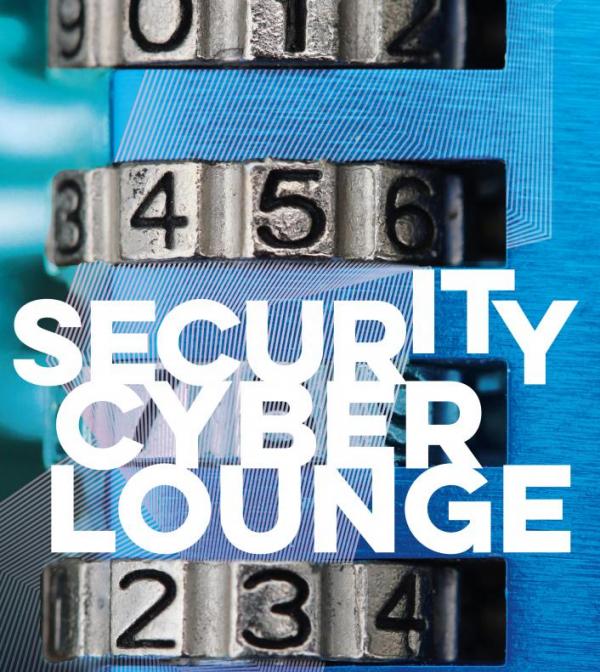Tech Trendscout Kolumne von Lisa Höllbacher
"Wo könnten wir eigentlich KI einsetzen?" – Diese Frage höre ich als Tech Scout und KI-Beraterin immer wieder. Die Erwartungshaltung ist oft hoch, die Unsicherheit ebenso. Viele Unternehmen suchen nach dem nächsten Gamechanger, dem einen Use Case, der alles transformiert. Doch allzu oft wird der Blick sofort auf Tools und Modelle gerichtet, ohne das eigentliche Problem zu kennen. Genau hier liegt der Knackpunkt: Wer nützliche KI-Lösungen finden will, muss mit einem Perspektivwechsel beginnen – und zwar beim Menschen und seinem konkreten Bedarf.
Problem-Punkt first: Warum der Fokus auf Nutzerbedürfnisse entscheidend ist
Ich erinnere mich gut an einen Workshop mit einem produzierenden Unternehmen. Begeistert stellte das Team eine Lösung mit Machine Learning für die Wartungsprognose vor. Auf Nachfrage stellte sich heraus: Die Datenbasis war lückenhaft, das eigentliche Problem lag nicht in der Vorhersage, sondern in der mangelhaften Erfassung von Fehlercodes. Was passiert war? Ein Lösungsvorschlag ohne Problemdefinition.
Solche Situationen sind keine Ausnahme. Sie zeigen, warum ein nutzerzentrierter Ansatz – "Problem-Punkt first"– so entscheidend ist. Methoden aus dem Design Thinking helfen dabei, echte Pain Points sichtbar zu machen. Anstatt gleich eine KI-Idee zu formulieren, beginnen wir mit Fragen wie: Wer ist betroffen? Was frustriert die Nutzer:innen im Alltag? Welche Entscheidungen wären datenbasiert besser?
KI Design Sprint: Struktur schafft Klarheit und Momentum
Ein Ansatz, der sich in meiner Praxis besonders bewährt hat, ist der KI Design Sprint. Inspiriert von Google Ventures Design Sprints, bietet er einen kompakten, strukturierten Prozess, um innerhalb weniger Tage nutzbare KI-Ideen zu entwickeln. Typisch sind ein, drei oder fünf Tage, in denen interdisziplinäre Teams mit methodischer Begleitung durch Übungen wie Empathy Mapping, Problemdefinition, Hypothesenbildung und Rapid Prototyping gehen.
In einem Medienunternehmen konnten wir durch einen dreitägigen Sprint neun Ideen generieren und auf drei strategisch relevante Use Cases verdichten. Der Sprint bringt Teams aus Fachbereichen, IT und Management an einen Tisch, schafft ein gemeinsames Verständnis und erlaubt schnelle Validierung. Besonders wirkungsvoll: Die Problem-Priorisierung auf Basis von Nutzerinterviews.
AI Use Case Canvas: Von der Idee zur Entscheidungsvorlage
Doch Ideen allein reichen nicht. Deshalb verwende ich im Anschluss an Sprints gern den AI Use Case Canvas. Dieses Framework ermöglicht es, Use Cases systematisch zu strukturieren und zu bewerten. Die Felder des Canvas – etwa Problem, Zielgruppe, Datenverfügbarkeit, Business Value, technische Machbarkeit und Risiken – helfen, komplexe Sachverhalte auf einen Blick zu erfassen.
In einem Workshop mit einem Energieversorger konnten wir damit 15 eingebrachte Ideen clustern, priorisieren und am Ende drei davon mit hoher Klarheit und Commitment zur Umsetzung bringen. Der AI Use Case Canvas dient dabei nicht nur der Dokumentation, sondern auch der Kommunikation gegenüber Stakeholdern: Er übersetzt Technik in Business-Sprache.
Fazit: Relevanz statt Hype
Der Weg zum richtigen KI-Use Case beginnt nicht bei der Technologie, sondern beim Menschen. Wer stattdessen mit einem Tool-first-Ansatz startet, riskiert leere Leuchtturmprojekte. Methoden wie der KI Design Sprint und der AI Use Case Canvas helfen, Klarheit zu schaffen, Beteiligte zu aktivieren und Potenziale realistisch einzuschätzen.
Mein Tipp: Startet klein, aber strukturiert. Beginnt mit echten Problemen und sprecht mit euren Nutzer:innen. Baut interdisziplinäre Teams auf, die neugierig und offen sind. Denn nur wer bereit ist, Fragen zu stellen, findet Antworten, die wirklich zählen. KI ist kein Allheilmittel – aber ein starkes Werkzeug, wenn es gut eingesetzt wird.
Wer Lust auf echte Einblicke und praktische Impulse hat:
Lisa Höllbacher ist beim CIO Kongress 2025 in Loipersdorf vor Ort und wird dort zeigen, wie aus vagen KI-Ideen tragfähige Use Cases werden.