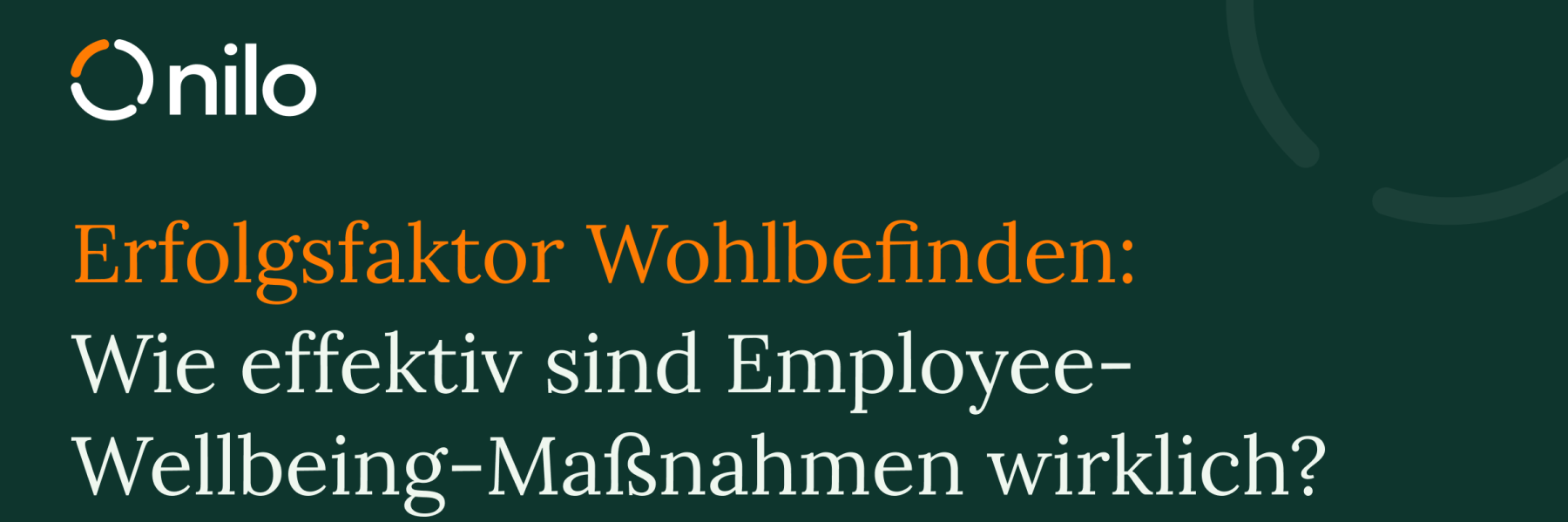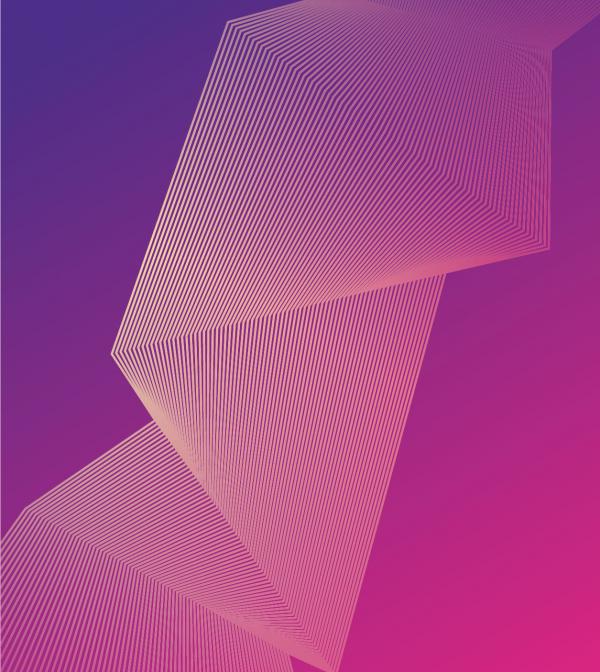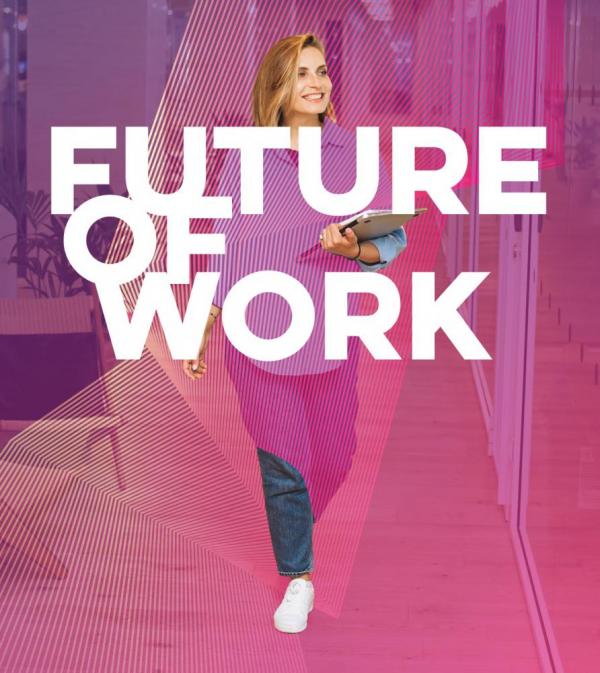Welche Maßnahmen wirklich wirken und wie du die richtigen für dein Unternehmen auswählst
Employee Wellbeing gehört zu den wichtigsten HR-Trends der letzten Jahre. Immer mehr Unternehmen erkennen, dass das Wohlbefinden ihrer Mitarbeitenden ein entscheidender Hebel für Motivation, Produktivität und Bindung ist und investieren entsprechend. Der Trend spiegelt sich auch in den Zahlen: 2025 verfügen weltweit bereits 87 % aller Organisationen über ein Wellness-Programm. Das entspricht einem Zuwachs von 61 % seit 2020.
Mit dieser wachsenden Bedeutung steigt auch die Vielfalt der Angebote: von Fitness- und Gesundheitsprogrammen über flexible Arbeitsmodelle bis hin zu umfassenden Services für mentale Gesundheit. Doch angesichts der Fülle an Möglichkeiten stellt sich die Frage: Wie wirkungsvoll sind diese Initiativen wirklich? Und nach welchen Kriterien lassen sich die passenden für das eigene Unternehmen auswählen?
Was fällt alles unter Employee-Wellbeing-Maßnahmen?
Employee-Wellbeing-Maßnahmen sind Initiativen, die das physische, mentale, emotionale und soziale Wohlbefinden am Arbeitsplatz fördern. Ziel ist es, eine Arbeitsumgebung zu schaffen, die Gesundheit, Zufriedenheit und Leistungsfähigkeit stärkt.
Die Bandbreite reicht von Gesundheitsangeboten bis zu kulturellen Initiativen, die Teamzusammenhalt und Sinnhaftigkeit fördern. Beispiele können sein:
Maßnahmen für das physische Wohlbefinden der Mitarbeitenden
- Ergonomische Arbeitsplätze wie höhenverstellbare Tische
- Fitnessangebote, medizinische Check-ups, gesunde Verpflegung
Maßnahmen für das mentale und emotionale Wohlbefinden der Mitarbeitenden
- Workshops zu Stressmanagement und Resilienz
- Psychologische Beratung, Coaching, Mental-Health-Benefits
- Flexible Arbeitszeitmodelle, Homeoffice-Optionen
Maßnahmen für das soziale Wohlbefinden der Mitarbeitenden
- Teambuilding-Events und Betriebsausflüge
- Anerkennungskultur, regelmäßige Feedbackgespräche
Wie effektiv sind Employee-Wellbeing-Maßnahmen?
Gut gemachte Wellbeing-Programme sind nicht nur ein Benefit für Mitarbeitende – sie wirken sich messbar auf zentrale Unternehmenskennzahlen aus. Studien zeigen, dass Investitionen in das Wohlbefinden der Belegschaft sowohl wirtschaftlich als auch kulturell spürbare Vorteile bringen:
- Auswirkungen auf den wirtschaftlichen Erfolg
Unternehmen mit hohen Wellbeing-Werten erzielen nachweislich bessere Geschäftsergebnisse. Laut einer aktuellen Analyse liegt der Return on Investment (ROI) bei 2,73 bis 4 US-Dollar für jeden investierten Dollar. Einzelne Angebote wie Mental-Health-Benefits erreichen sogar das Fünffache dieser Rendite. - Auswirkungen auf die Produktivität
Zufriedene Mitarbeitende arbeiten im Schnitt 12 % produktiver, wie Forschende der University of Warwick herausfanden. Einen positiven Einfluss auf Produktivität zeigt auch eine Studie von nilo auf: 51 % Mitarbeitende, die das Angebot von nilo nutzen, gaben an, motivierter zu sein. In Einzelfällen berichten Unternehmen wie Google von Produktivitätssteigerungen im Milliardenwert. - Auswirkungen auf Mitarbeitergesundheit und Krankheitstage
56 % der Beschäftigten in den USA geben an, durch Wellbeing-Maßnahmen seltener krank zu sein. Ein besonders relevanter Aspekt dabei: Psychisch bedingte Krankheitsausfälle dauern im Schnitt deutlich länger als körperliche – im Durchschnitt 43,3 Tage. Präventive Programme zur Gesundheitsförderung wirken dem nicht nur entgegen, sondern reduzieren auch die Folgekosten: Laut Gallup können burnoutbedingte Fluktuationen um bis zu 20 % der gesamten Gehaltskosten verringert werden. - Auswirkungen auf die Mitarbeiterbindung
Organisationen mit einem systematischen Wellbeing-Ansatz verzeichnen eine um 11 Prozentpunkte niedrigere Fluktuationsrate. Gleichzeitig steigt die Mitarbeiterzufriedenheit, Bindung und das Engagement deutlich. Solche Programme wirken nachweislich einer „inneren Kündigung“ oder dem bloßen „Dienst nach Vorschrift“ entgegen.
Wie finde ich die passenden Maßnahmen für mein Unternehmen?
Die Vielfalt an Wellbeing-Programmen kann die Auswahl zur Herausforderung machen. Unterschiedliche Ansätze, Formate und Zielsetzungen sorgen dafür, dass die Entscheidung oft komplexer ist, als es auf den ersten Blick scheint. Um nicht den Überblick zu verlieren, lohnt es sich, strukturiert vorzugehen und einige wesentliche Punkte zu beachten:
-
Bedarfsanalyse
Am Anfang steht die Frage, welche Maßnahmen im eigenen Unternehmenskontext wirklich wirksam sind. Dazu braucht es ein klares Bild der aktuellen Situation – sowohl aus Sicht der Mitarbeitenden als auch anhand objektiver Unternehmensdaten.
Anonyme Befragungen geben wertvolle Einblicke in Bedürfnisse, Erwartungen und bestehende Herausforderungen. Ergänzend helfen Feedbackgespräche und die Auswertung von Austrittsinterviews, Muster und wiederkehrende Probleme zu erkennen. Betriebsstatistiken wie Fehlzeiten, Fluktuationsraten oder die Nutzung bereits vorhandener Angebote liefern zusätzliche Fakten, die bei der Priorisierung unterstützen.
-
Ziele und Budget klären
Sind die Bedarfe erfasst, folgt der nächste wichtige Schritt: klare Zieldefinitionen. Sollen die Fehlzeiten sinken, die Bindung ans Unternehmen gestärkt oder die Produktivität gesteigert werden? Je präziser die Ziele formuliert sind, desto leichter lassen sich geeignete Maßnahmen auswählen und später deren Erfolg messen.
Parallel dazu gilt es, das verfügbare Budget realistisch zu bestimmen und die Ziele zu priorisieren. So lässt sich sicherstellen, dass die wichtigsten Ziele mit den vorhandenen Mitteln optimal unterstützt werden.
-
Abstimmen auf Werte & Kultur
Wellbeing-Maßnahmen entfalten die größte Wirkung, wenn sie zur Identität des Unternehmens passen – sowohl inhaltlich als auch kulturell. Angebote sollten die gelebten Werte widerspiegeln und sich harmonisch in die bestehende Arbeitskultur einfügen. Auch Rahmenbedingungen wie Unternehmensgröße, Branche und Arbeitsorganisation sind entscheidend: Ein dezentral organisiertes Team braucht andere Formate als ein Unternehmen mit festen Arbeitszeiten, und internationale Standorte bringen zusätzliche kulturelle Aspekte ins Spiel.
Unterschiedliche Berufsgruppen und Generationen setzen zudem unterschiedliche Schwerpunkte. Jüngere Mitarbeitende priorisieren oft Flexibilität, Weiterbildung und Entwicklungsmöglichkeiten, während andere Zielgruppen Gesundheits- oder Vorsorgeangebote bevorzugen.
Praxis-Tipp: Analysiere zunächst bestehende Unternehmensdokumente wie Leitbild, Vision und Mission, Strategieunterlagen oder Markenwerte. Prüfe, welche Werte dort klar verankert sind und wie sie sich in der aktuellen Unternehmenskultur widerspiegeln – etwa durch Führungsgrundsätze, Entscheidungsprozesse oder interne Kommunikation. Ergänzend helfen HR-Daten und Kennzahlen, gezielt Maßnahmen zu wählen, die diese Werte am stärksten unterstützen. Beispiele:
- Wert „Teamgeist“: Regelmäßige Team-Retreats, Peer-Mentoring, gemeinsame Sport- oder Sozialprojekte
- Wert „Nachhaltigkeit“: Jobrad-Leasing, plastikfreie Kantine, ressourcenschonende Gesundheitsprogramme
- Wert „Offenheit und Vertrauen“: Vertrauliche Beratungsangebote, Employee Assistance Programme (EAP), Schulungen zu Stressbewältigung und Resilienz, offene Kommunikation über mentale Belastungen
-
Mitarbeitende beteiligen
Eine aktive Einbindung der Belegschaft sorgt dafür, dass Maßnahmen nicht nur top-down eingeführt, sondern auch wirklich angenommen werden. Nachdem eine Vorauswahl möglicher Angebote getroffen wurde, lohnt es sich, diese gemeinsam zu diskutieren – etwa durch anonyme Umfragen oder Abstimmungsrunden.
So können Mitarbeitende ihre Perspektiven einbringen und sich mit den Entscheidungen identifizieren. Führungskräfte sollten früh im Prozess beteiligt sein, damit sie die Einführung in ihren Teams aktiv unterstützen und als Multiplikatoren wirken.
-
Maßnahmenmix zusammenstellen und einführen
Ein guter Maßnahmenmix deckt mehrere Dimensionen ab – physische, psychische, soziale, finanzielle und sinnstiftende Angebote. Die Auswahl sollte auf den definierten Zielen, den ermittelten Bedarfen und der Unternehmenskultur basieren. So lassen sich Maßnahmen passgenau auf die Situation im Unternehmen zuschneiden: Bei hoher Stressbelastung bieten sich zum Beispiel Coaching-Angebote oder Workshops zur Stressbewältigung an, bei hohen Fluktuation Programme zur Mitarbeiterbindung und Anerkennung.
Für den Start empfiehlt sich ein praxisnaher Ansatz: Pilotprojekte in einzelnen Abteilungen oder Teams ermöglichen es, Wirkung und Resonanz zu testen, bevor das Programm unternehmensweit ausgerollt wird. Orientierung an Best-Practice-Beispielen ähnlicher Unternehmen oder Branchen kann zusätzliche Impulse liefern – wichtig ist jedoch, diese Konzepte an die eigenen Strukturen und Werte anzupassen.
Ebenso zentral ist eine klare interne Kommunikation: Ziele, Nutzen und konkrete Inhalte sollten transparent vermittelt und regelmäßig wiederholt werden, um Akzeptanz und Beteiligung zu sichern.
-
Führungskräfte mit ins Boot holen
Die Rolle von Führungskräften ist entscheidend für den Erfolg jeder Wellbeing-Initiative. Ihr Umgang mit Mitarbeitenden, ihre Haltung zu Themen wie Pausen, Work-Life-Balance oder mentaler Gesundheit prägt maßgeblich die Kultur im Team. Gleichzeitig sind sie wichtige Multiplikatoren: Sie tragen die Programme in die Teams, kommunizieren Inhalte, schaffen Akzeptanz – und nicht zuletzt den nötigen Raum im Arbeitsalltag, damit Maßnahmen überhaupt greifen können.
Damit sie diese Rolle gut ausfüllen können, sollten nicht nur Maßnahmen für die Belegschaft, sondern auch speziell auf Führungskräfte zugeschnittene Wellbeing-Angebote vorgesehen werden. So stellen Unternehmen sicher, dass auch ihre individuellen Bedürfnisse berücksichtigt werden – und Führungskräfte langfristig in der Lage sind, ihre Teams wirksam zu unterstützen.
Schulungen und Sensibilisierungsmaßnahmen helfen zusätzlich, ihre Vorbildfunktion zu stärken und sie zu aktiven Treibern der Programme zu machen.
-
Erfolg messen & kontinuierlich optimieren
Eine klare Erfolgskontrolle stellt sicher, dass Wellbeing-Maßnahmen dauerhaft relevant bleiben und ihre Ziele erreichen. Dafür eignen sich sowohl Kennzahlen als auch qualitative Rückmeldungen. Je nach Programm lassen sich zusätzlich anonymisierte Gesundheitsdaten auswerten, stets unter Einhaltung aller Datenschutzvorgaben.
Mögliche KPIs im Überblick:
- Teilnahmequote an Wellbeing-Maßnahmen
- Employee Net Promoter Score (eNPS)
- Fluktuationsrate
- Anzahl und Dauer von Fehlzeiten
- Veränderung von Wohlbefinden oder Stressbewertungen
- Ergebnisse zu mentaler Gesundheit aus Fragebögen
- Nutzung psychologischer Beratungsangebote
Praxis-Tipp: Kombiniere quantitative Daten wie Teilnahmequoten, Fehlzeiten und Fluktuationsraten mit qualitativen Insights aus Umfragen, Feedbackgesprächen oder Fokusgruppen. Führe diese Erhebungen regelmäßig durch, beispielsweise vierteljährlich, um Entwicklungen im Zeitverlauf sichtbar zu machen. Definiere die KPIs von Anfang an klar und verknüpfe sie mit den ursprünglichen Zielen der Wellbeing-Maßnahmen. Auf dieser Basis lassen sich Programme gezielt anpassen, erweitern oder neu ausrichten.
Fazit: Employee Wellbeing strategisch verankern
Gut aufgesetzte Wellbeing-Maßnahmen können weit mehr bewirken als nur ein positives Arbeitsklima – sie steigern Produktivität, reduzieren Fehlzeiten und stärken die Bindung der Mitarbeitenden. Welche Wirkung sie entfalten, hängt jedoch stark davon ab, wie passgenau sie entwickelt und umgesetzt werden. Unternehmen, die Bedarfe sorgfältig analysieren, klare Ziele formulieren und Angebote eng an Werte, Kultur und Belegschaft ausrichten, schaffen die Basis für Programme, die nicht nur gut klingen, sondern im Alltag spürbar wirken. Die Einbindung von Mitarbeitenden und Führungskräften, ein ausgewogener Maßnahmenmix sowie eine kontinuierliche Erfolgsmessung sichern, dass Angebote relevant bleiben und langfristig Nutzen stiften.
So wird Employee Wellbeing nicht nur zu einem festen Bestandteil der Unternehmensstrategie – sondern auch zu einem messbaren Wettbewerbsvorteil.
Fotocredit: nilo